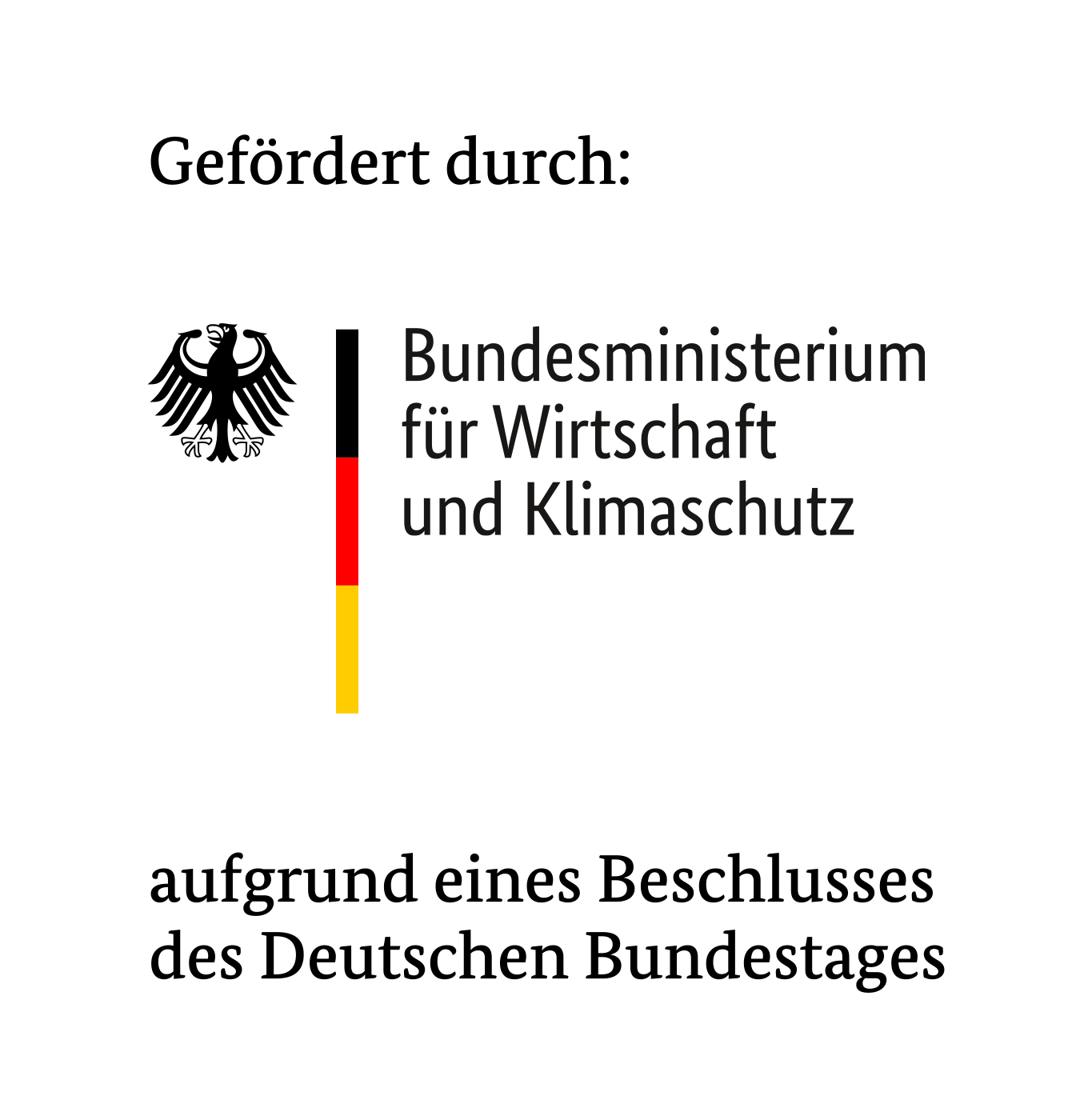CORNET-CRUFI
Modellierung des instationären Wärme- und Feuchteverhaltens und Prognose der Bewehrungskorrosion bei Beton und Recycling-Beton
Laufzeit: 01.05.2023 - 30.04.2024
Projektpartner: Fraunhofer IBP - Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP Stuttgart, FH Campus Wien, CEFET MG, Trägerverein Institut für Holztechnologie Dresden e. V.

In diesem Projekt wird die Dauerhaftigkeit von Beton mit und ohne chloridhaltige rezyklierte Gesteinskörnung bei unterschiedlichen Expositionen und unter Berücksichtigung des CO2-Bindungsvermögens untersucht. Dazu werden instationäre Vorhersagemodelle für die Bewehrungskorrosion in Abhängigkeit von Temperatur, Feuchtigkeit, Korrosivität und Zeit entwickelt.
Bewehrungsstahl ist im Beton normalerweise durch die Alkalität des Betons vor Korrosion geschützt. Wenn Karbonatisierung auftritt, kann dieser Schutz verloren gehen. Während die Karbonatisierung in trockenem Beton schnell und in feuchtem oder nassem Beton viel langsamer verläuft, verhält sich die Korrosion umgekehrt. Während für die Karbonatisierung bereits Berechnungsmodelle zur Verfügung stehen, fehlen sie für die instationäre Prognose des Korrosionsfortschritts in Abhängigkeit von Temperatur, Feuchte, Zeit und Korrosivität des Betons. Auch werden detaillierte Materialeigenschaften für den zeitabhängigen Flüssigkeits- und Dampftransport in den verschiedenen Bereichen des Betons benötigt, da bisher effektive Eigenschaften für den Transport durch die Betondeckung für das feuchtigkeitsresistente Material ausreichend zu sein schienen. Zur Schonung der natürlichen Ressourcen Sand und Kies und auch zur Erhöhung der Wiederverwertungsquote gewinnt die Verwendung von rezyklierten Gesteinskörnungen im Beton an Bedeutung. Dabei soll auch chloridbelastetes Material verwendet werden, was bisher wegen der chloridbedingten Korrosionsgefahr kaum geschieht. Unter eher trockenen Bedingungen (z.B. in Innenwänden) ist der Einsatz wahrscheinlich gut möglich, zumindest wenn die Chloridkonzentration auf ein unkritisches Maß begrenzt wird. Darüber hinaus kann Recyclingbeton große Mengen an CO2 binden, insbesondere wenn Zementstein des alten Betons zerkleinert wird. Allerdings kann dieser Prozess das Korrosionsrisiko zusätzlich erhöhen. Daher erfordert der Einsatz von Recyclingbeton mit Chloriden und beschleunigter Karbonatisierung eine klare und zuverlässige Planung und Definition der Einsatzbereiche. Darauf aufbauend werden hygrothermische Simulationswerkzeuge und Bewertungsmodelle entwickelt, die es ermöglichen, für jeden Anwendungsfall und Betrieb vorherzusagen, ob und in welchem Umfang eine Korrosionsgefährdung der Bewehrung zu befürchten ist und wie diese z.B. durch Änderung des Aufbaus oder der Materialien oder durch Beschichtungen verhindert werden kann. Zu diesem Zweck werden Normal-, Recycling- und CO2-absorbierende Betone betrachtet. Die neuen Vorhersagemöglichkeiten werden es ermöglichen, Korrosionsprobleme zu vermeiden, kosteneffiziente Sanierungsmaßnahmen zu entwickeln und den Einsatz von Recyclingbeton auszuweiten und gleichzeitig die CO2-Bilanz von Betonbauwerken zu verbessern. Das Konsortium besteht aus dem Trägerverein Institut für Holztechnologie Dresden e.V., der für die Gesamtkoordination des Projekts verantwortlich ist, dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, das auf Bauphysik und hygrothermische Simulation spezialisiert ist, der Hochschule München mit dem Forschungsschwerpunkt Recyclingbeton und Korrosion, der FH Campus Wien, Österreich, mit dem Interessenschwerpunkt Karbonatisierung und CO2-Bindung von Beton und dem Federal Centre for Technological Education of Minas Gerais, Brasilien, als Experte auf dem Gebiet der Zementsubstitute für CO2-arme Betonbindemittel.
Zuwendungsgeber: